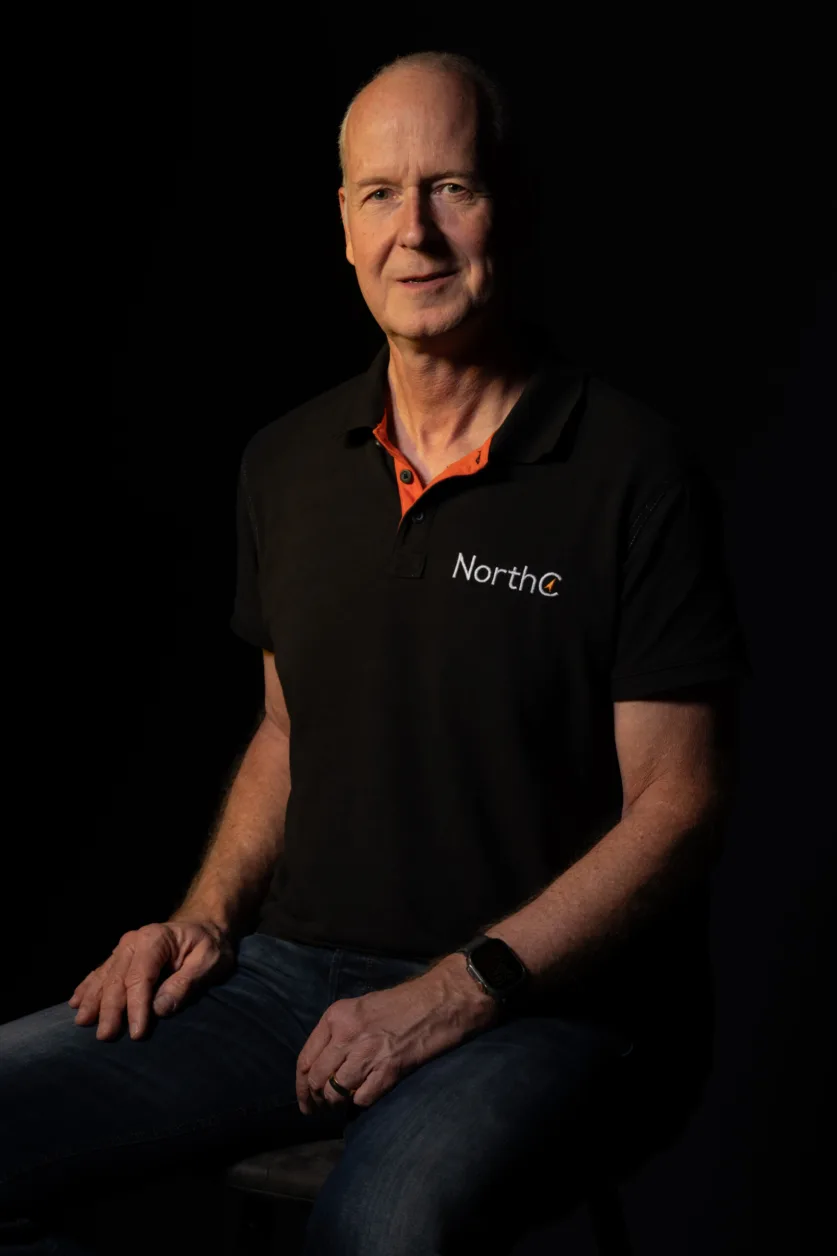Moderne KI-Anwendungen und High-Performance-Computing (HPC) stellen heute deutlich höhere Anforderungen an Rechenzentren als noch vor wenigen Jahren. Besonders High-Density-Umgebungen, also IT-Racks mit sehr hoher Leistungsaufnahme, werden zunehmend zum Standard. Viele bestehende Rechenzentren sind jedoch ursprünglich für deutlich geringere Leistungsdichten geplant worden.
Doch was passiert, wenn Ihre Infrastruktur noch auf Low-Density ausgelegt ist – und ein Kunde plötzlich deutlich höhere Dichten benötigt?
In diesem Beitrag erklären wir, was „High Density“ in der Praxis bedeutet, welche Anforderungen dadurch an Kühlung, Energieversorgung und Infrastruktur entstehen und wie sich bestehende Standorte effizient und pragmatisch nachrüsten lassen, ohne dass ein kompletter Umbau notwendig ist. Zum Abschluss zeigen wir anhand eines realen Beispiels aus unserem Standort bei Basel, wie eine solche Modernisierung erfolgreich umgesetzt werden kann.
Was verstehen wir unter einem Rechenzentrum mit hoher Dichte?
In klassischen Rechenzentren liegt die typische Leistungsaufnahme pro Rack meist zwischen 3 und 12 kW. Moderne KI- und HPC-Cluster sprengen diesen Rahmen jedoch deutlich: Leistungswerte von bis zu 100 kW pro Rack sind heute keine Seltenheit – und das oft mit dauerhaft hohen Lasten sowie kurzfristigen Training-Spikes, die das System zusätzlich fordern.
Diese massiven Leistungs- und Wärmemengen verändern die Anforderungen an ein Rechenzentrum fundamental: Stromverteilung, Kühlkonzept und operativer Betrieb müssen für deutlich höhere Belastungen ausgelegt sein.
Kurz zusammengefasst:
-
Verschiebung der Leistungsdichte:
Von 3–12 kW pro Rack in herkömmlichen Umgebungen hin zu bis zu 100 kW pro Rack für KI- und HPC-Anwendungen. -
Mehr und konstantere Abwärme:
Höhere kontinuierliche thermische Lasten plus dynamische Peaks während des Trainings. -
Konsequenz:
Reine Luftkühlung genügt in vielen Fällen nicht mehr – alternative oder hybride Kühlmethoden werden notwendig.
Warum KI und HPC die Kühlungsgleichung verändern
Mit der wachsenden Grösse moderner Modelle und Datensätze steigen auch die Anforderungen an die zugrunde liegende Hardware. Beschleuniger wie GPUs oder TPUs verbrauchen heute deutlich mehr Strom und erzeugen kontinuierlich hohe Wärmelasten – oft über viele Stunden oder sogar Tage hinweg. Diese thermische Dynamik verändert die klassische Kühlungsstrategie grundlegend.
Um die Zuverlässigkeit der Hardware zu gewährleisten und Leistungseinbussen durch thermisches Throttling zu vermeiden, reicht reine Luftkühlung in vielen Fällen nicht mehr aus. Immer mehr Unternehmen setzen daher auf flüssigkeitsunterstützte Kühlmethoden – etwa Rear-Door-Heat-Exchanger oder Direct-to-Chip-Lösungen.
Die wichtigsten Gründe:
-
Höhere thermische Belastungen:
KI- und HPC-Racks erzeugen deutlich mehr Wärme als herkömmliche Server und benötigen ein stabileres Kühlkonzept. -
Steigender Energieverbrauch:
Systeme mit vielen Beschleunigern treiben den Gesamtenergiebedarf des Rechenzentrums massiv nach oben. -
Langanhaltende Lastspitzen:
Trainingsläufe und Simulationen sorgen nicht für kurzfristige Peaks, sondern für mehrstündige bis mehrtägige Phasen extrem hoher Leistungsaufnahme.
Ein praktischer Weg zu hoher Dichte
Ein unkomplizierter und wirkungsvoller Ansatz zur Nachrüstung bestehender Rechenzentren ist die Installation von Rückwand-Wärmetauschern (RDHx). Dabei wird an der Rückseite des Racks ein Wärmetauscher angebracht, der die heisse Serverabluft aufnimmt und mithilfe von Wasser kühlt, bevor die Luft zurück in den Raum gelangt.
Da Wasser rund 3.000-mal mehr Wärme aufnehmen kann als Luft, lassen sich so erhebliche Effizienzgewinne erzielen – und das, ohne die gesamte Rechenzentrumshalle umbauen zu müssen.
Zusätzlich kann RDHx bei steigender Dichte mit direkter Flüssigkeitskühlung kombiniert werden, um besonders heiße Komponenten wie GPUs oder CPUs gezielt und effizient zu temperieren.
Planung für hohe Dichte: Stromversorgung, Betrieb, Compliance
Der Übergang zu High-Density-Umgebungen betrifft weit mehr als nur die Kühlung. Auch Stromversorgung, Betriebsprozesse und regulatorische Anforderungen müssen mitwachsen.
- Stromversorgung:
Planen Sie für dauerhaft hohe Lasten und mögliche Leistungsspitzen. Dazu gehören eine sorgfältig ausgelegte Stromverteilung, ausreichende Redundanzen sowie Schutzmechanismen, die auf höhere Leistungsdichten vorbereitet sind. - Betrieb:
Flüssigkeitsunterstützte Kühlung verändert gewohnte Abläufe im IT-Betrieb. Die frühere Grundregel, „Wasser gehört nicht in den Datenraum“, gilt so nicht mehr. Deshalb sind klare Prozesse, Schulungen und Sicherheitsstandards entscheidend, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten. - Compliance und Datenresidenz:
Nachrüstungen und Upgrades müssen weiterhin alle nationalen und EU-weiten Vorgaben erfüllen – von Sicherheitsrichtlinien bis hin zu Datenschutzanforderungen. Gleichzeitig benötigen KI-Workloads eine geringe Latenz, weshalb die Infrastruktur standortnah und leistungsstark geplant werden sollte.